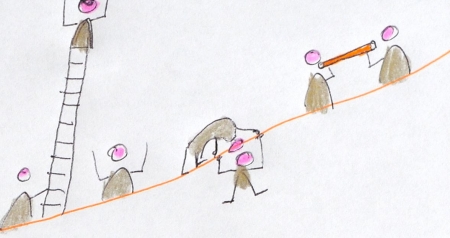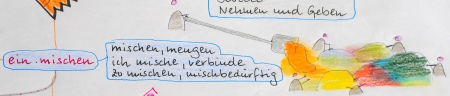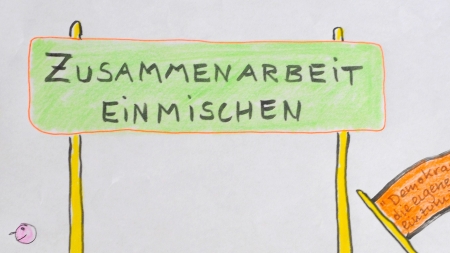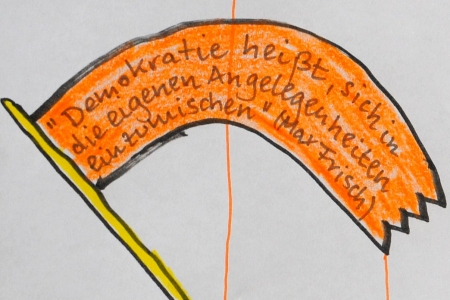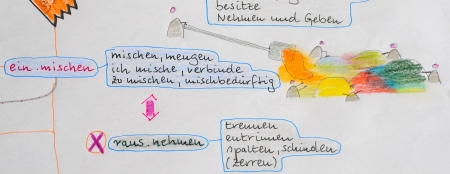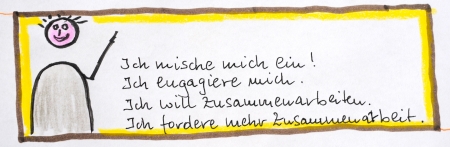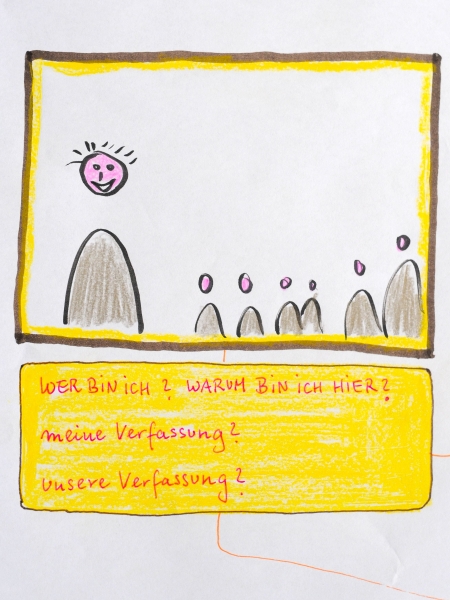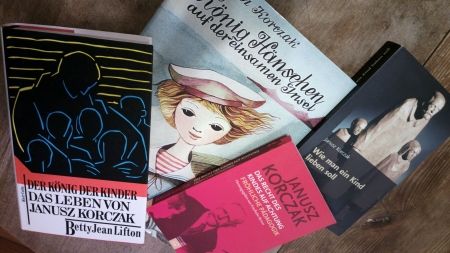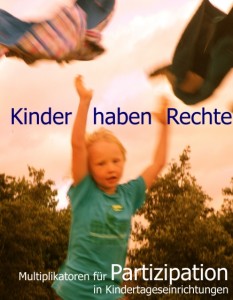Gleichwürdigkeit und Leitwolf sein
(Jesper Juul: Leitwolfsein. Elterliche Führung der Zukunft und ihr geschichtliche Hintergrund. Edition + plus, 03 familylab Schriftenreihe, München 2014)
Hier eine Passage aus den Seiten 27-30:
Der Prozess gegenseitigen Lernens geht ein Leben lang weiter, und er wird am meisten Erfolg haben, wenn die Beziehung als gleichwürdig gesehen wird. Beziehungen zwischen Eltern und Kinder können niemals gleichberechtigt sein, dafür ist der Machtunterschied zu groß. Dieser Unterschied ist genau der Grund, warum ich den Begriff Gleichwürdigkeit eingeführt habe – er beschreibt das Ethos der Führung durch Erwachsene.
Beispiel
Max ist drei Jahre alt.
Sein Vater: Auf geht’s Max! Jetzt ist es Zeit, dass du Zähne putzt.
Max: Aber, Papa, warum? Ich will nicht Zähne putzen!
Vater: Weißt du, warum du nicht willst?
Max: Nein … ich will einfach nicht.
Vater: Schade, ich würde es wirklich gerne wissen.
Max: Ich weiß es aber nicht.
Vater: Okay, dann denk doch mal darüber nach und sag mir Bescheid, wenn du es weißt. Und lass uns in der Zwischenzeit das Zähneputzen erledigen.
Max: Aber ich hab gesagt, dass ich nicht will!
Vater: Ja, das habe ich gehört. Aber solange du noch ein Kind bist, bin ich verantwortlich für deine Gesundheit. Also los, bringen wir es hinter uns.
Max: Okay, aber pass auf, dass du mir nicht wehtust.
Ginge man nach dem alten Paradigma, würde man diesen Dialog als pure Zeitverschwendung sehen. Der Vater weiß, dass er seinem Sohn auf jeden Fall die Zähne putzen wird, warum also so viel Zeit und Energie verschwenden?
Der Grund ist folgender: Continue Reading »