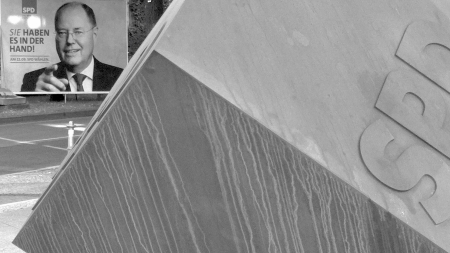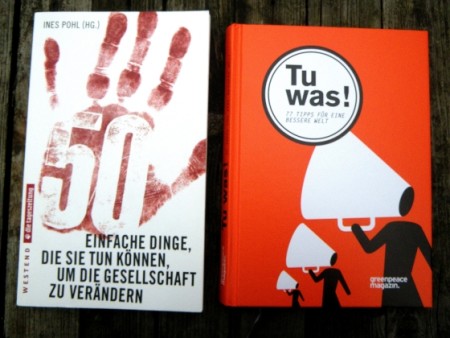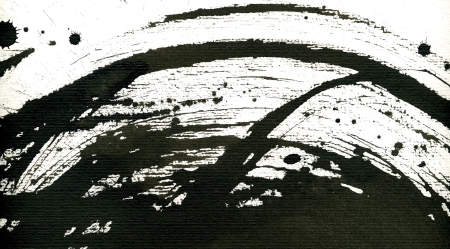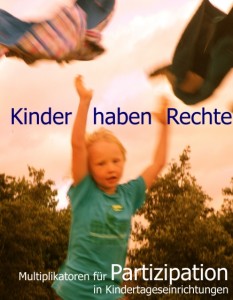Yasmina Banaszczuk
wird von Juliane Löffler in der Wochenzeitung „der Freitag“ vom 14.11.13 porträtiert.
Sie machte Vorschläge zu mehr Demokratie in der SPD.
„Wir wollen mehr Demokratie wagen“ (Willy Brandt).
Nun ist sie nach zwei Jahren frustriert ausgetreten
(siehe Ihren Blog).
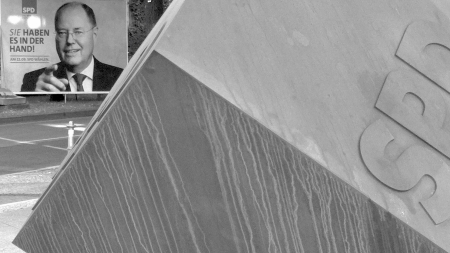
Foto: Andreas Schönefeld
Naiv oder konsequent?
Ein Lehrstück über Parteien und Demokratie!?
Auf der online-Seite des Freitags der Artikel mit Kommentaren.
Hier und hier weitere Diskussionsbeiträge dazu.
Was tust Du?
Parteien müssen offener werden?
Engagierst Du Dich in Deiner Gemeinde, im Ort, in Deiner Stadt?
In der Jugendarbeit, in Vereinen, in (Bürger-)Initiativen, in einer Gewerkschaft, als Klassensprecher, in einer Partei?
Was kannst Du geben?
Bevor ich aufliste, was Parteien heute machen könnten, um wieder offener, demokratischer, bürgernäher zu sein, erzähle ich noch schnell eine Geschichte.
Es passierte nach einer Podiumsdiskussion vor der Kommunalwahl 2008. Vertretern aller Parteien hatten sich im Niebüller Gymnasium (Friedrich-Paulsen-Schule) vorgestellt. Nachher standen wir noch vor der Schule, Anja Rosengren und ich, beide Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen in Niebüll und Region. Da fragte uns ein junger Mann: „Was sagt Ihr dazu …, was macht Ihr …, müsst Ihr nicht …“. Anja antwortete: „Müssen, müssen wir schon einmal gar nichts“ … und … „was machst Du für die Gesellschaft?“
Da war es passiert. Diese Frage traf tief. Der junge Mann hieß Valentin Seehausen. Anfang 2009 trafen sich Anja und Valentin zufällig in Niebüll. Valentin hatte diese Frage oft und lange hin und her gedreht, sie hatte sich bei ihm eingenistet. Nun war es soweit. Er wollte was tun! Wir suchten gerade einen geeigneten Kandidat für den Bundestagswahlkampf. Valentin wurde unser Kandidat.

Valentin Seehausen Bundestagskandidat 2009, Foto: Andreas Schönefeld
Weiterlesen »
Tu was! 77 Tipps für eine bessere Welt, Hg: Greenpeace Media GmbH, Hamburg 2011
Es gibt nichts Gutes. Außer: man tut es. Erich Kästner
Einfach die Welt verändern. 50 kleine Ideen mit großer Wirkung. Hg: we are what we do, München/Zürich 2006.
50 einfache Dinge, die Sie tun können, um die Gesellschaft zu verändern, Hg: Ines Pohl, Frankfurt/Main 2010.
Wir sollten niemals daran zweifeln, dass eine kleine Gruppe engagierter Bürger die Welt verändern
kann; tatsächlich sind sie die Einzigen, die das jemals getan haben.
Margaret Mead, US-amerikanische Anthropologin
.
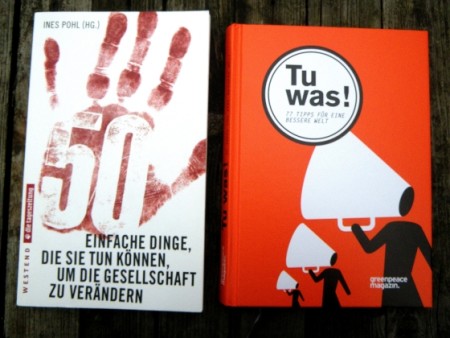
Foto: Andreas Schönefeld
„Demokratie heißt,
sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen“ (Max Frisch)
Aber wie gelingt dies? Was könnte jede/r machen? Wie soll man sich engagieren, wenn man in Armut lebt, keinen Arbeitsplatz hat, Hartz-IV-Betroffener ist, wenn viele am gesellschaftlichen Leben kaum teilnehmen können, weil sie nicht genügend Geld haben?
Meist stöhnen die politischen Parteien und Fraktionen in den städtischen Parlamenten über die viele, viele Arbeit und über die wenigen, wenigen Mitglieder. Wie gelingt es, dass Demokratie, Politik und das Einmischen in die eigenen Angelegenheiten wieder besser zu einander kommen? Wie gelingt es, gemeinsam öffentlich zu debattieren und zu handeln? Streit, Kompromiss, Aussöhnung und Solidarität im politischen Engagement für die eigene Stadt oder Gemeinde würden doch stark und glücklich machen.
Wie öffnen sich die starren Formen des repräsentativen Politiksystems und des Verwaltungshandelns gegenüber den Mutbürgern, gegenüber zeitlich befristeter Mobilisierung zu einzelnen Themen und Projekten?
Wie kann die außerparlamentarische Vielfalt, Professionalität, der Sachverstand und die Expertise genutzt werden, um Gesellschaft zu gestalten?

Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, Foto: Andreas Schönefeld
Das Wissen und Engagement der Vielen macht für den Politikwissenschaftler Roland Roth unsere Gesellschaft zukunftsfähig. In seinem im Herbst 2011 erschienen Buch „Bürgermacht. Eine Streitschrift für mehr Partizipation“ analysiert er die Krisen der Demokratie.
Weiterlesen »
Beschweren erlaubt!
10 Empfehlungen zur Implementierung von
Beschwerdeverfahren in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe
.
„Das Vorhandensein formell festgeschriebener Beschwerdeverfahren allein reicht nicht aus, um zu sichern, dass Kinder und Jugendliche diese auch in Anspruch nehmen. Vielmehr müssen weitere Bedingungen erfüllt sein, damit Kinder und Jugendliche sich ermutigt fühlen, ihre Anliegen und Beschwerden zu äußern.
Entscheidenden Einfluss auf die Nutzung der strukturell verankerten Verfahren haben die Kultur einer Einrichtung und die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weiterlesen »
„Bis jetzt hing alles
vom guten Willen
und von der guten
oder schlechten Laune
des Erziehers ab.
Das Kind war nicht berechtigt,
Einspruch zu erheben.
Dieser Despotismus
muss ein Ende haben.“
Janusz Korczak 1920

Foto: Andreas Schönefeld
Ohne Partizipationsverfahren und Beschwerdeverfahren erhalten Kindertagesstätten, Kinderheime, stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe seit Anfang 2012 keine Betriebserlaubnis. Partizipation muss nachgewiesen werden!
Das Gesetz zur Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) erhält einen neuen Paragrafen. Der §8b lautet im Punkt (2) wie folgt:
Weiterlesen »

Foto: Andreas Schönefeld
Ein Kind ist aus hundert gemacht.
Ein Kind hat
hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen zu denken
zu spielen und zu sprechen.
Weiterlesen »
Missbrauchte Macht – Pädagogik als Unterdrückung
.
Ulrich Bartosch (Prof. an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstatt). Beitrag unter dem Titel „Missbrauchte Macht – Pädagogik als Unterdrückung“, in „Differenz und Dialog. Anerkennung als Strategie der Konfliktbewältigung, Hg: Vera Flocke/Holger Schoneville, Berlin 2011
… dass jede Erziehung und jede Pädagogik zunächst unter dem Generalverdacht steht, als Machtmissbrauch angelegt zu sein und Unterdrückung zu betreiben.
Will sie den Verdacht entkräften, muss die je konkrete Erziehung und die je allgemeine Pädagogik nachweisen, wie sie Machtmissbrauch verhindert und Unterdrückung aufhebt (S. 126f).

Foto: Andreas Schönefeld
Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern
Richard David Precht (Philosoph, Publizist, Honorarprof. an der Universität Lüneburg). Anna, die Schule und der Liebe Gott, München 2013
Ein Prozent Wissensstoff bleibt also vermutlich von allem Gelernten übrig! Und dafür quälen sich unsere Kinder und Jugendliche jeden Tag sechs bis neun Stunden pro Wochentag in der Schule herum, fürchten sich vor Klassenarbeiten, leiden unter Stresssymptomen, sammeln Frust an, belasten das Familienklima und lernen oft vor allem eins: Wie man das Lernen hasst! (S. 114)
(erstmals erschienen auf beste-stadt.net am 10.01.2013)
Worum geht’s hier in diesem Artikel?
Wie können wir unseren Alltag und unsere Arbeit durch Demokratie verbessern? Indem wir auch unserer Chefs kritisieren – Beschwerden sollten auf allen Ebenen unbedingt erwünscht sein und gefördert werden! Weiterhin sei die Frage gestellt, schützen Beschwerdeverfahren vor sexualisierter Gewalt?
Gestern tickerten wieder die Meldungen: … sexualisierte Gewalt in der Kirche … Katholische Kirche opfert Aufarbeitung … Kampagne „kein Raum für Missbrauch“ ….
Bei diesem Thema wird es so deutlich. Auf allen gesellschaftlichen Ebenen und auf allen Ebenen in pädagogischen Einrichtungen braucht es: Offenheit, das direkte Gespräch und die Austragung von Konflikten. Mit einem Wort „mehr Demokratie“.
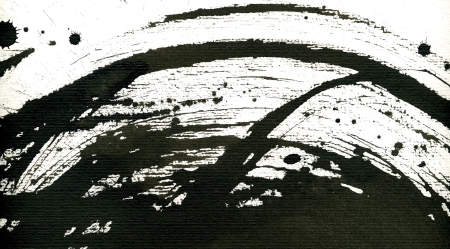
Foto: Andreas Schönefeld
Weiterlesen »